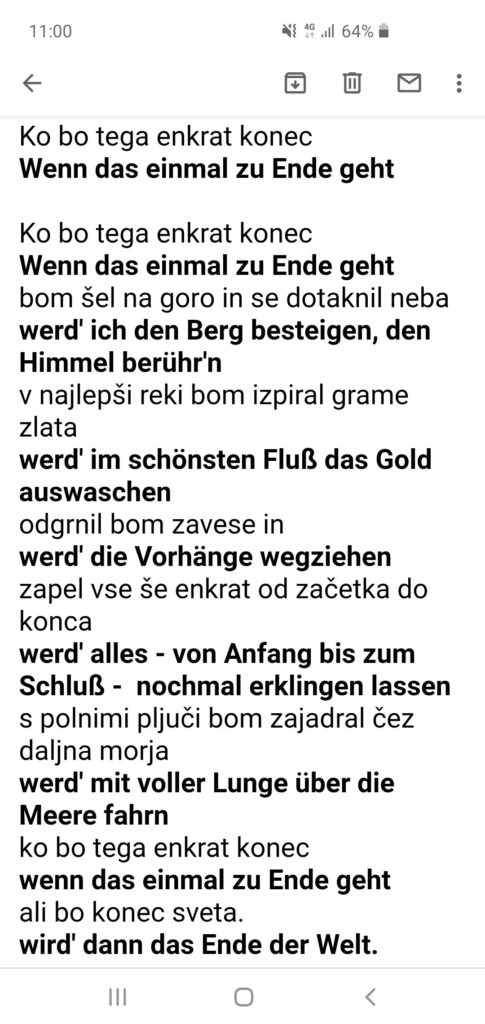Wir leben in einer Zeit, die mit der Bewältigung der aktuellen Pandemie uns nicht vergessen lassen darf, dass die geistige noch viel tiefer sitzt und immer wieder in Wellen über uns kommt, mit Mechanismen des Vergessens und Verdrängens, die auch schon von der Menschheit Erreichtes sehenden Auges mitreißen, gewollt oder nicht.
Ich fühle mich zweigeteilt, gebremst und kontrolliert, diszipliniert und äußerlich ruhig, finde aber innerlich nicht die richtige Ruhe. Ich arbeite viel, doch weiß ich nicht, wohin es führt, versuche der Kulturpolitik zu folgen und die handelnden Personen in Land und Bund zu überzeugen und auf die Gefahren hinzuweisen, in denen alle Kultursparten zunehmend versinken. Es erschöpft, die vielen Ankündigungen und die Reden von raschen Maßnahmen und dass „niemand zurückgelassen werden soll“ bedrängen die tagtägliche Selbstmotivation. Hinzu kommt, dass die Banken nicht gerade vor Umsetzungswillen sprühen und dass Worte der Politik mit den Taten der Banker nicht unbedingt korrelieren. Oder umgekehrt.
So schreibe ich in diesen Tagen, denke, telefoniere, koche, redimensioniere die Kräuterschnecke; am wenigsten noch gelingt das Lesen; zu vieles rauscht und lenkt ab …
Eine gute Ablenkung war die Arbeit an einem großen Interview für die Wochenendbeilage der slowenischen Wochenzeitung Delo, das vor einer Woche erschien und großes Echo hervorrief. Quer durchs Land, vom ehemaligen Ministerpräsidenten bis zum einfachen Lagerarbeiter, kamen zustimmende Anmerkungen, insbesondere zu den klaren Darlegungen zu Peter Handke durch meine Zurückweisung der unqualifizierten Anschwärzungen.
Was auffällt: Ein Leben, in dem die Zukunft so generell unklar, wo das Reisen und die freie Bewegung so reglementiert ist – und das nach meist nachvollziehbaren Kriterien –, ist wie ein Achter im Fahrrad: man kommt zwar irgendwie voran, aber wie bei einer permanenten Schlaglochtour. Was wäre es erst, wenn die Maßnahmen autoritär, reaktionär und diktatorisch wären, wie im Faschismus?
Und: es fällt auf und offenbart sich, wie seicht und oberflächlich der Lebenstiefgang und das Gehabe verschiedenster Akteure ist. Es desillusioniert. Vor allem, wenn es um die wirklichen Fragen der Zukunft geht. Die Blendung ist zwar angezählt, umso deutlicher sieht man, wie die hohlen Sätze daherplätschern …
Der Herbst wirft seine Schatten voraus. Die Arbeiten am Herbstprogramm sind bei Drava und bei Wieser voll im Gange. Ist das verzweifelter Mut, der uns treibt? „Ist die Kuh durch die Öffnung der Buchhandlungen wirklich vom Eis“, wie sich Tim Jung von Hoffman & Campe fragt? Und werden die Frühjahrsbücher zu ihrer Leserschaft finden, noch bevor die Herbsttitel das Licht der Welt erblicken, oder werden sie nur gemeinsam ein erneutes Aufbäumen wagen müssen, in der Hoffnung, nicht wieder allein gelassen zu werden, nicht wieder auf die Nase zu fallen? Wenn die Ankündigung des Kärntner Landeshauptmanns Peter Kaiser, die Jahresförderung sofort auszahlen zu wollen, als Schwalbe des Frühjahrs verstanden werden kann, die vom Süden fliegend auch in Wien gesehen, gehört und verstanden wird, könnte es vielleicht gelingen.
Ich habe soeben – als Selbstbeschwörung? – für den Herbstkatalog im Antescriptum geschrieben: „Es lebe das Buch!“ Ich habe mich entschieden und vertraue der spanischen Schriftstellerin Irene Vallejo, die sagt: „Bücher sind unsere Verbündeten.“
So soll es sein, so wird es (hoffentlich) sein – auch dank Erika, Matei, Josef, Jasna, Thomas, Dietmar, David, Selina, Dunja …, die aus den erzählenden Sätzen und Versen der Autorinnen und Autoren, der Übersetzerinnen und Übersetzer, schöne, haptische und aufmunternde, nachdenkliche, befreiende Bücher machen, auf die wir uns stützen.
In Erinnerung an Raimund Fellinger, der am 25. April verstarb. Uns verband eine jahrzehntelange Freundschaft. Reise gut, mein Freund!
„Zu schweigen erstarre ich auch stets, wenn man mir Vorwürfe macht, anscheinend bin ich prädestiniert, solche auf mich zu ziehen“, schreibt Raimund Fellinger im März 2011 in einem Mail.
Im Magazin der Süddeutschen stellte er fest: „Selbstzweifel sind immer gut. Man nutzt doch Literatur, um sich als Leser in Frage zu stellen. Wer im Umgang mit der Literatur keine Ironie gelernt hat, dem ist im Leben nicht mehr zu helfen.“ (SZ, 22.2.2016)